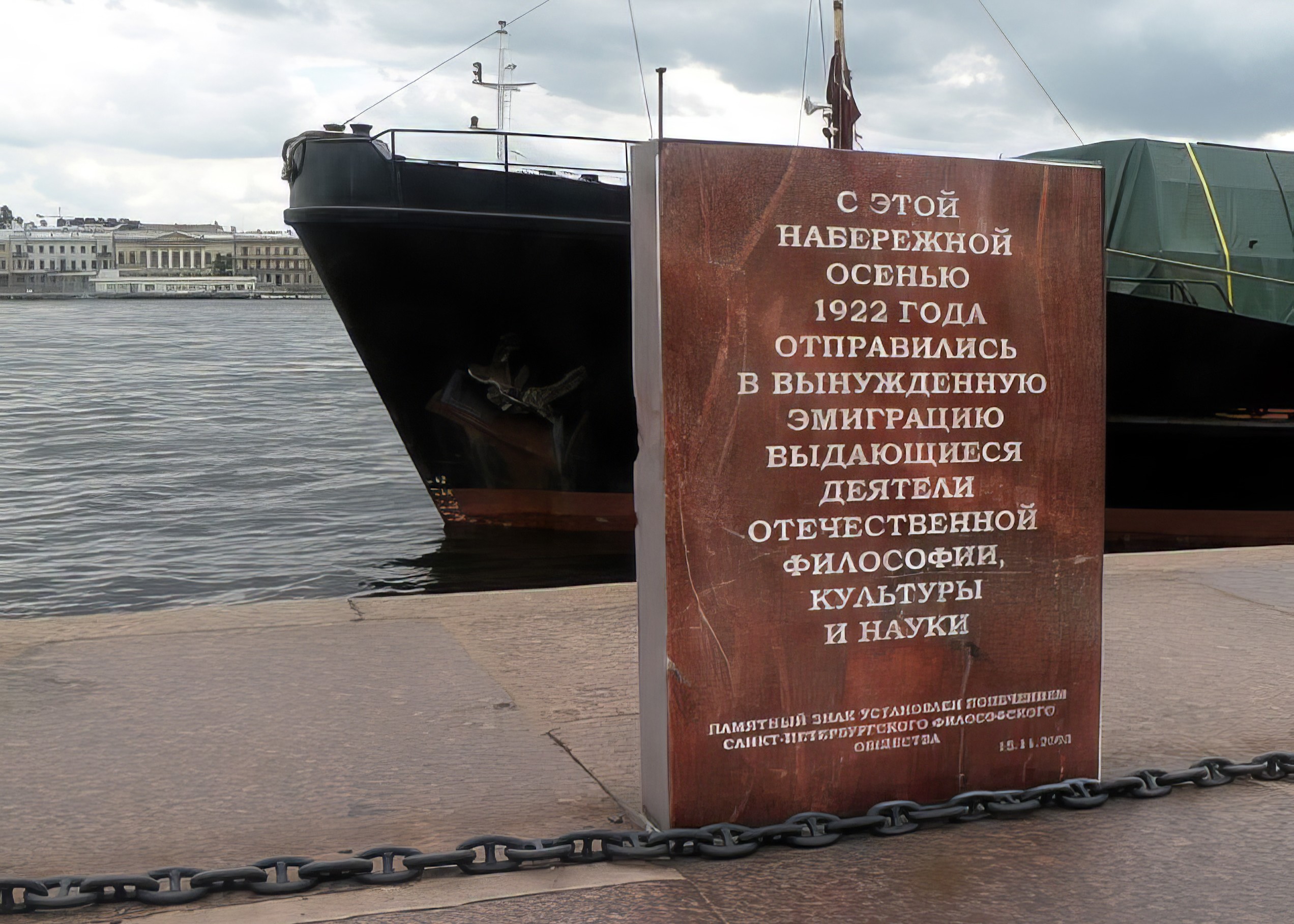Was Leben im Exil bedeutet, ist den meisten, die sich mit der Geschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem von Hitler besetzten Europa beschäftigen, geläufig. Emigration und Exil sind aber auch eine Erfahrung der Gegenwart wie zuletzt die Flucht aus Putins Russland und die neue russische Diaspora in Europa und Übersee zeigen.
Mit dem Ende der Sowjetunion war, so schien es, auch die Geschichte der russischen Emigration zu einem Ende gekommen. Die Grenzen waren offen, die in Jahrzehnten entstandene Kultur des Exils kehrte in die Heimat, aus der sie verbannt worden war, zurück, prominente Gestalten des Exils wie Alexander Solschenizyn kehrten sogar nach Russland zurück. Alles deutete auf eine Normalisierung. Doch es kam anders. Eine neue Welle der Flucht hat spätestens seit Putins Repressionen im Innern und dem Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Alles sieht aus nach einem déjà vu jenes „Russlands jenseits der Grenzen“, das es vor mehr als einem Jahrhundert, nach Revolution und Bürgerkrieg, schon einmal gegeben hat.
Am Ende seiner eindrucksvollen Darstellung der russischen Diaspora zwischen 1919 und 1939“, erschienen 1990, meinte Marc Raeff, dass dieses Kapitel abgeschlossen sei, es gebe „Russia Abroad“ nicht mehr. Er war mit seiner Einschätzung damals nicht allein. Jahrzehnte lang verbotene Autoren der Exil-Literatur erschienen In der Zeit von Perestroika und Glasnost in Riesenauflagen, die Werke von als dekadent abgestempelten Künstlern des Silbernen Zeitalters oder der Avantgarde, wurden endlich in großen Ausstellungen gezeigt, russische Philosophen, die es wie Nikolai Berdjajew im Westen zu Weltruhm gebracht hatten, wurden endlich auch in Russland selbst rezipiert. Und nicht zuletzt: ein lebhaftes Hin und Her über die nun offene Grenze hinweg setzte ein, Shopping-Touren oder Kulturtourismus, Wiederaufnahme des Kontakts mit der Welt draußen. Es sind die Jahre, in denen mit einem Mal in europäischen Städten überall Russisch zu hören war, sich russischsprachige communities bildeten, mit allem, was dazugehörte: Netzwerken, Infrastrukturen, Zeitungen, Supermärkten, Kindergärten. Es war die Zeit, in der man von Charlottengrad und Londongrad sprach und russische Gemeinden auch in Bangkok und Goa antreffen konnte. Beginn einer grossen Wanderung, mit Übergängen zwischen Sightseeing und Braindrain. Die Rede ist nicht nur von den „neuen Russen“, die Immobilien an der Cote d’Azur oder in Kensington erwarben, sondern von Abertausenden, die es sich leisten konnten, sich vorübergehend oder für immer im Ausland niederzulassen. Die Angaben zur Zahl derer, die allein in den 2000er Jahren das Land verlassen haben, sind unvollständig und schwanken zwischen ein bis zwei Millionen, besonders hoch ist der Anteil der gut ausgebildeten, modernisierungswilligen Angehörigen der Art Mittelklasse, die jederzeit auch jenseits der Grenzen einen Job hätten finden können oder auch fanden. Für das Land ein entsetzlicher Blutverlust, der an die Situation nach 1917 erinnerte.
Doch was mit Putins Krieg gegen die Ukraine begann, war nicht einfach die Fortsetzung von stiller (normaler) Migration und brain drain der IT-Spezialisten und all derer, die nicht auf bessere Zeiten warten wollten, sondern es war die Flucht all jener, die mit Verfolgung, Anklagen, harten Urteilen, Lagerstrafen und Gefahr für Leib und Leben rechnen mußten. Es war die Situation, in der von heute auf morgen Lebensentscheidungen zu treffen waren, in der es zu Kilometer langen Staus an den Grenzübergängen nach Georgien und Kasachstan kam, wo die Flüge nach Istanbul und Tel Aviv ausgebucht waren und sich Fragen stellten, auf die es kaum eine Antwort gab: Was geschieht mit der zurückgelassenen Wohnung, wer kümmert sich um die zurück gebliebenen alten oder kranken Eltern, wohin kann man überhaupt ausreisen? Von heute auf morgen mussten Probleme gelöst werden: Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, die Beschaffung einer Wohnung, die Suche eines Arbeitsplatzes, der Zugang zu Bankkonten usf. Ausdruck einer Panik war die Flucht von etwa 800.000 jungen wehrfähigen Männern, die sich vor der Mobilmachung im Herbst 2022 über die Grenzen absetzten, von denen aber viele später zurückkehrten – hier kam der Terminus von den „Relokanten“ statt der Emigranten auf. Anders erging es all jenen, die als Kriegsgegner unmittelbar bedroht waren und denen nichts blieb als sich bis auf Weiteres im Ausland in Sicherheit zu bringen. Dabei waren sie als Flüchtlinge, die aus dem Land des Aggressors kamen und die Mietpreise in Tiflis oder Jerewan in die Höhe trieben, nicht überall willkommen. So entstanden, abhängig von den jeweiligen Einreise- und Aufenthaltsbedingungen, von der Situation auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, der sprachlichen und kulturellen Situation, mit der man fertig werden musste, neue Knotenpunkte, Zentren, Hubs: Istanbul, Belgrad, aber auch Taschkent und sogar Ulan Bator oder die aus Urlaubstagen vertraute Insel Bali. In vielem deckte sich die Topographie der neuen Diaspora mit der der ersten Welle nach Revolution und Bürgerkrieg: Paris, Prag, Berlin. Riga und Vilnius.
Und doch ist der Unterschied der jetzigen Welle zu den vorangegangenen Wellen gravierend: die erste umfasste das ganze Spektrum der vorrevolutionären, anti-bolschewistischen politischen und kulturellen Elite, ein Russland im Wartestand, Schattenregierung und Armee eingeschlossen. Der zweite Schub nach dem Zweiten Weltkrieg rekrutierte sich wesentlich aus den im Westen gebliebenen Ostarbeitern, Sowjetsoldaten und Displaced Persons, die nach Übersee weiterwanderten, und die dritte Welle ab den 1970er Jahren bestand wesentlich aus zum Teil zwangsexilierten prominenten Dissidenten und der großen Gruppe der sogenannten Russlanddeutschen und sowjetischen Juden. Die ins Exil gedrängte oder geflüchtete Schicht von heute stammt meines Erachtens in erster Linie aus den Reihen von Menschen- und Bürgerrechtlern, von verfolgten Minderheiten und Kriegsgegnern, all jenen also, die als Repräsentanten und „Agenten des feindlichen Auslandes“ diffamiert und verfolgt werden, als „Fünfte Kolonne des Westens“, Gegner der „traditionellen russischen Werte“, die angeblich vom Regime Putins und der orthodoxen Kirche verteidigt werden.
Während die Gegner der Putin-Diktatur als Agenten des Liberalismus und der westlichen Dekadenz für vogelfrei erklärt werden, hat Putin alles aus dem ideologischen Erbe der russischen Diaspora übernommen, was in das toxische Gemisch des Putinismus paßt. Seit seinem Machtantritt hat er in großangelegten „Welt-Kongressen der Landsleute“ seine Idee der „russischen Welt“ propagiert, der all jene, die auch im Ausland in irgendeiner Weise der russischen Sprache und Kultur zugerechnet werden können, ganz besonders aber die Nachkommen russischer Aristokraten mit klingenden Namen. Die Heimholung der sterblichen Überreste des monarchistischen und NS-freundlichen Philosophen Iwan Iljin und des „weissen“ Generals Anton Denikin gehört zu dieser Strategie ebenso wie die Popularisierung der Lehre der Eurasier oder die Wiedervereinigung der Auslandskirche mit dem Moskauer Patriarchat. Zur Instrumentalisierung von „Russland jenseits der Grenzen“ gehört heute – wie schon in den 1920er Jahren - nicht nur der Kulturkampf, sondern auch die Unterwanderung durch den Geheimdienst. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich bei dem, was oft als „russische Emigration“ bezeichnet wird, in Wahrheit um eine russischsprachige Emigration handelt. Das zeigt sich heute besonders in der Spaltung der russischsprachigen communities, wenn es um die Haltung zum russisch-ukrainischen Krieg geht.
Wie jedes Exil lebt auch das heutige von der Hoffnung und Zuversicht, eines Tages in die Heimat zurückkehren zu können. Wann dies geschehen wird, kann niemand sagen – wie man an der Geschichte des russischen Exils im 20.Jahrhundert ablesen kann. Auf der russischen Opposition außerhalb Russlands liegt nicht nur die Pflicht, mit dem „anderen Russland“ in Verbindung zu bleiben und diesem eine Stimme zu geben, sondern eröffnet auch die Chance, das Exil als exterritorialen Ort der Reflexion, als privilegierten Ort des freien und furchtlosen Nachdenkens über Russlands Zukunft zu nutzen, das Archiv der russischen Freiheitsbewegung weiterzuführen und die Beziehung Russlands zur Welt, die Putin zerschneiden will, aufrecht zu erhalten. Es liegt aber auch an den Gastländern, die Bedingungen, unter denen dies möglich ist, so gut es geht, zu garantieren.