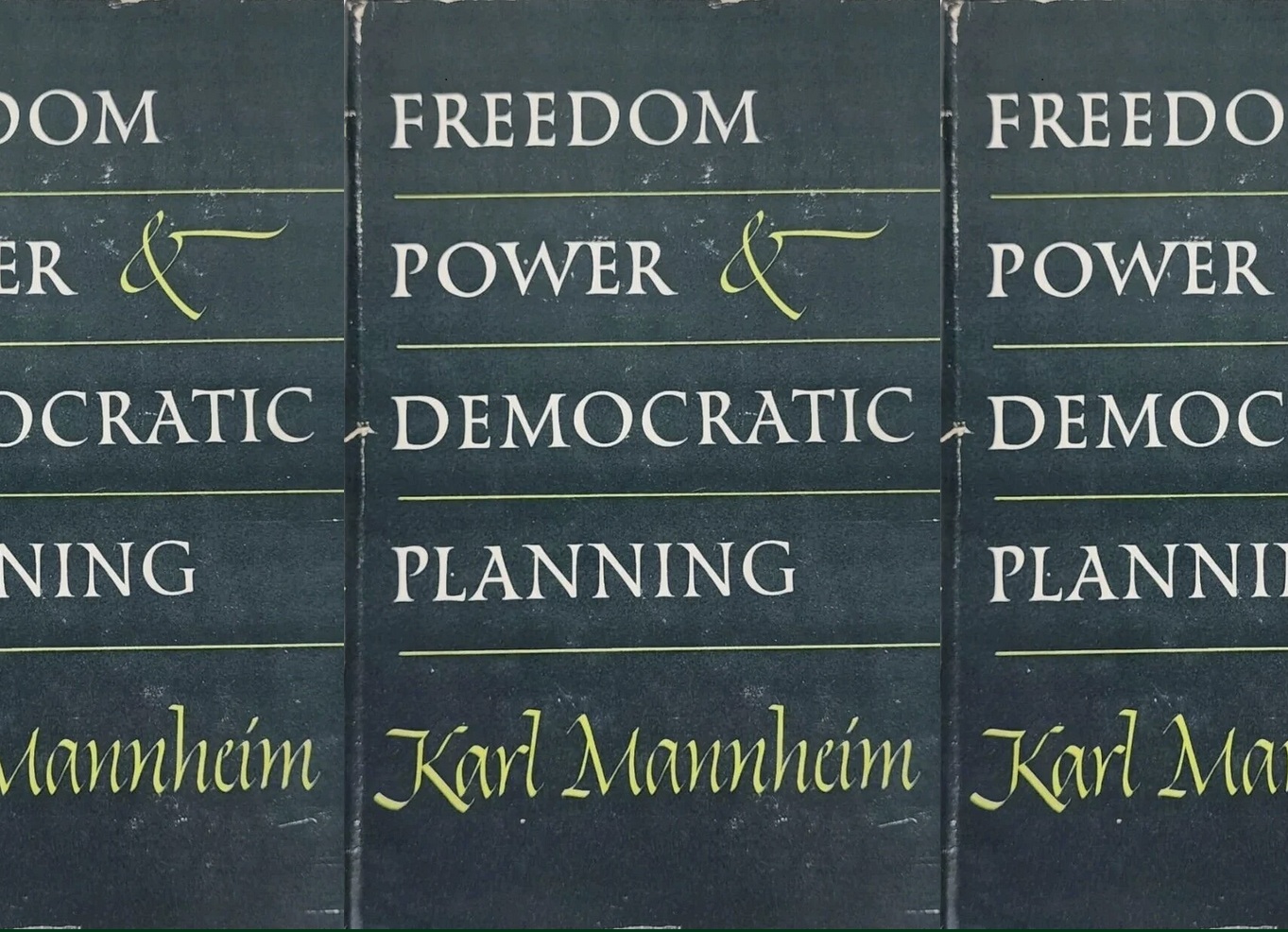Karl Mannheims Demokratietheorie ist einer Tradition demokratischen Denkens verpflichtet, das um den schwankenden Boden des Parlamentarismus, der Gewaltenteilung und des Rechtstaates weiß und daraus die Forderung ableitet, deren kulturelle und soziale Voraussetzungen zu pflegen und zu verteidigen.
Wenige Wochen vor seinem 54. Geburtstag starb Karl Mannheim am 9. Januar 1947 in London. Kurz darauf notierte sein Cousin Ernest in einem Nachruf, Mannheim habe sich angesichts des Niedergangs der ersten deutschen Demokratie zunehmend für die politische Bedeutung von „sozialen Kräften“ interessiert. Nach seiner Vertreibung aus Frankfurt im April 1933 habe er sich an der London School of Economics vor allem mit der „Krise des Liberalismus“ beschäftigt und als Heilmittel die „Planung in einer freien Gesellschaft“ empfohlen. Sozialwissenschaftler müssten konkrete Vorschläge machen, wie die Demokratie zu stärken sei, und auch vor der politischen Zeitdiagnose nicht zurückschrecken. Andernfalls fiele das Gemeinwesen „in die Hände der modernen Condottieri“.
Unter den vielen unvollendeten Publikationsprojekten Karl Mannheims sticht sein letztes Buch mit dem Titel „Essentials of Democratic Planning“ hervor, an dem er sechs Jahre lang gearbeitet hatte. Gemeinsam mit seiner Witwe Júlia, einer Psychoanalytikerin und Kinderpsychologin, überarbeiteten drei Kollegen das Manuskript. Im Sommer 1950 erschien Freedom, Power and Democratic Planning in New York, im folgenden Jahr in London.
Seit dem Erscheinen dieses Buches sind 75 Jahre vergangen und einige der mächtigsten Staaten der Welt scheinen in die Hände von modernen Condottieri gefallen zu sein. Als die gefährlichsten „Feinde der Demokratie“ galten Mannheim nicht „die Konservativen [...], sondern die Condottieri, die darauf aus sind, die demokratische Regierung als Mittel zur rechtmäßigen Veränderung zu stürzen, um mit Hilfe des Mobs eine Tyrannei zu errichten“. Es liegt vor diesem Hintergrund nahe, Mannheims Plädoyer für demokratische Planung neu zu entdecken. Freedom, Power and Democratic Planning gehört in die Hände all jener, die glauben, die Krise der pluralistischen Demokratie sei bereits überwunden, wenn es gelänge, bei der nächsten Wahl jenen Parteien Prozentpunkte abzunehmen, welche die Demokratie mit demokratischen Mitteln überwinden wollen.
Mannheims Idee der „Planung für die Freiheit“ ist als ein Paradox zu begreifen: Weil die Zukunft kontingent und in diesem Sinne nicht planbar ist, ist es für Demokratien unverzichtbar, vorausschauend zu handeln. In diesem Sinne zielte die Idee der „demokratischen Planung“ auf „soziale Gerechtigkeit statt absoluter Gleichheit, mit einer Differenzierung von Belohnungen und Status auf der Grundlage echter Gleichheit anstelle von Privilegien“ und auf die „schrittweise Umgestaltung der Gesellschaft, um die Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern, d.h. Planung, aber nicht Reglementierung“.
Wer sich in den 1930er- und frühen 1940er-Jahren fragte, wie die Demokratie ihre Fassung bewahren könnte, dem stand noch als Schreckbild vor Augen, wie viele den Versprechungen des Faschismus oder des Stalinismus glaubten. Statt am Laissez-faire-Liberalismus festzuhalten, gelte es, die Demokratie „wehrhaft“ zu machen. Hatte Karl Loewenstein unter dem Begriff der wehrhaften Demokratie vor allem repressive Mittel wie das Verbot verfassungfeindlicher Parteien und die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit verstanden, galt Mannheim eine Demokratie als wehrhaft, wenn sie die Festigung und die Pflege ihrer sozialen und kulturellen Voraussetzungen als eine umfassende Aufgabe für Staat und Zivilgesellschaft begriff, statt sie an den Verfassungsschutz oder die politische Bildung zu delegieren. Die Demokratie könne nur überleben, indem sie „alle ihre Institutionen gründlich auf demokratische Ziele“ ausrichte. Deshalb sei es notwendig, sich deren „erzieherische Wirkung“ bewusst zu machen.
Der Frage, was es heißen könnte, demokratische Lebensformen zu pflegen, wendet sich Mannheim im dritten und längsten Teil des Buches zu. Ziel der „demokratischen Planung“ sei es, psychologische, soziologische und historische Erkenntnisse zu nutzen, um „demokratisches Verhalten“, ein „demokratisches Gewissen“ und eine „demokratische Persönlichkeitsstruktur“ zu stärken. Eine Demokratie müsse daher sicherstellen, dass überall der Geist der Freiheit zu spüren sei. „Die Welt der Erwachsenen“ spiegele „die Welt der Kindheit und Jugend wider“, so Mannheim. Wer in der Kindheit keine demokratischen „Einstellungen, Gewohnheiten und Ansprüche“ entwickele, könne dies später nicht nachholen. Für Mannheim setzen demokratische Lebensformen eine demokratische Persönlichkeit und Verhaltensmuster voraus, die er auf den Begriff des „integrativen Verhaltens“ brachte, weil es das „Urbild demokratischen Handelns“ verkörpere. Wer die Krise der Demokratie analysiere, so der Soziologe, konzentriere sich meist auf Verfahrenstechniken demokratischer Herrschaft. Aus dem Blick geraten sei dagegen die Frage, „welchen Typus von Bürger“ die Demokratie „schaffen will“. Mannheim war bewusst, dass sich demokratische Verhaltensmuster nicht einfach verordnen lassen. Umso dringlicher sei es in einer Demokratie, die Formen des Zusammenlebens zu pflegen, welche die Chance bieten, ein demokratisches Ethos zu verinnerlichen. Hinter dem spröden Begriff des integrativen Verhaltens verbirgt sich der Gedanke, dass ein guter Demokrat nicht nur darauf verzichtet, „anderen seine eigene Sichtweise und seinen eigenen Willen aufzuzwingen – das Wesen der herrschsüchtigen Haltung“. Vielmehr müsse er andere Meinungen aus Prinzip dulden: „Er ist nicht um des Kompromisses willen tolerant, sondern in der Erwartung, seine eigene Persönlichkeit zu erweitern, indem er einige Züge eines Menschen aufnimmt, der sich wesentlich von ihm unterscheidet. Konkret bedeutet dies, dass die demokratische Persönlichkeit Meinungsverschiedenheiten begrüßt, weil sie den Mut hat, sich dem Wandel auszusetzen“.
Gegen die wohlfeile Rede vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, setzt Mannheim auf ein Verständnis der Demokratie, in dessen Zentrum Konflikt und Dissens steht. Demokratisches Zusammenleben sei „mehr als ein Kompromiss“, es setze die Fähigkeit voraus, Widersprüche und Ambivalenz auszuhalten. Entscheidend sei, dass Menschen eine „gemeinsame Lebensform“ schaffen, „obwohl sie sich der Tatsache bewusst sind“, wie sehr ihre politischen Haltungen sich wegen „ihrer körperlichen Verfassung, ihrer sozialen Stellung, ihrer Triebe und Interessen, ihrer Erfahrungen und Lebenseinstellungen“ unterscheiden. Die Demokratie lebe davon, „dass es Menschen gibt, die gegen den Strom schwimmen, und es gehört zur demokratischen Erziehung, dass es unter ihnen gute Schwimmer gibt“.
Wie bei anderen Mitgliedern seines Gesprächszirkels The Moot galt Mannheims Sorge einem „instrumentellen Verständnis“ demokratischen Zusammenlebens. Die Demokratie brauche nicht allein das Wissen um Fakten. Sie setze auch „Überzeugungen“ und das Gespür dafür voraus, wie notwendig „Erziehung“ von Kindern, Erwachsenen und Greisen sei. Mannheim fragte daher, ob es nicht hilfreich sein könnte, „Geschichten zu erzählen, die einen erzieherischen Wert und eine humanisierende Kraft haben“, obwohl sie dem entgegenstehen, „was unsere Faktenfinder als geprüfte Wahrheit präsentieren“. Je weiter die Begrifflichkeit der „Sozialwissenschaften und der Psychologie“ um sich greife, desto mehr ginge der Sinn für „Ambiguität“ verloren. Politiker wie Bürger stünden schließlich „ohne Sprache da.“
Für Mannheim hatte ein neues Zeitalter begonnen, in dem „Techniker der Propaganda“ mit rationalen Mitteln bestimmte „Gefühle“ erzeugen. Je weiter sich diese Manipulation ausbreite, desto mehr sehnten sich die Menschen nach einem Führer, „der über die Kräfte der Inspiration und Vision verfügt“. Angesichts der grassierenden Irrationalität sah es Mannheim als umso dringlicher an, ein Gespür dafür zurückzugewinnen, dass Menschen nicht nur materielle Interessen, sondern auch emotionale und psychische Bedürfnisse haben. Es griffe zu kurz, irrationale Stimmungen mit vernünftigen Argumenten bekämpfen zu wollen. Entscheidend sei, Irrationalismus „bewusst zu zügeln und zu bremsen“.
Die Demokratie ist jüngst in schwere See geraten. Wie viele ‚gute Schwimmer‘ in den letzten Jahren herangezogen wurden, wird sich zeigen. Der Blick von der Brücke, der sich allein für Parlamente, Wahlen und Parteien interessiert, führt jedenfalls ins Leere. Seit der zweiten Amtseinführung Trumps stehen die Demokratien vor ihrer größten Bewährungskrise seit den 1940er Jahren. Umso reizvoller ist es, Mannheims politisches Testament neu zu lesen. Mannheims pluralistische Demokratietheorie weiß um den schwankenden Boden des Parlamentarismus, der Gewaltenteilung und des Rechtstaates; und leitet daraus die Forderung ab, deren kulturelle und soziale Voraussetzungen zu pflegen und zu schützen. Dem Soziologen stand vor Augen, dass Menschen das Licht der Welt weder als tugendhafte Demokratinnen noch als mündige Bürger erblicken. All das fällt nicht vom Himmel. Die demokratische Haltung bedarf des ständigen Gebrauchs und der demokratischen Praxis.
Till van Rahden, Université de Montréal, ist Historiker. Zuletzt erschien: Vielheit: Jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus (Hamburger Edition, 2022). Er war wiederholt Fellow am IWM.